Wie geht es Kindern und Jugendlichen heute – zwischen Leistungsdruck, digitalem Dauerstress und gesellschaftlichen Umbrüchen? Drei Fachfrauen aus Forschung, Beratung und Praxis besprechen, was junge Menschen brauchen.
Kurzvorstellung
• Kornelia Huber-Danzer leitet ein heilpädagogisches Kinderhaus.
• Birgit Riedel war 20 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Jugendinstitut, mit dem Schwerpunkt Kindertagesbetreuung und internationale Betreuungspolitiken.
• Nina Hartmann ist systemische Supervisorin, Mental Health First Aid Youth-Trainerin und langjährige psychosoziale Beraterin für belastete Familien.
Infokasten
- 20–25 % der Jugendlichen sind psychisch belastet
- Nur jede*r 6.–7. erhält zeitnah Hilfe
- 22 % berichten ihre Lebensqualität sei gering
- 25% berichten von Angstsymptomen
- Prävention und frühe Unterstützung wirken
Quelle: Copsy-Studie
Wie geht es Kindern und Jugendlichen heute?
B. Riedel: Studien zeigen: Rund ein Fünftel der jungen Menschen ist psychisch belastet. Viele berichten über Stress, Selbstzweifel und hohen Erwartungsdruck – quer durch alle sozialen Schichten.
K. Huber-Danzer: In der heilpädagogischen Arbeit sehe ich Kinder, die sensibel auf Veränderungen reagieren. Sie brauchen Struktur, Zuwendung und Erwachsene, die präsent sind. Fachkräftemangel und steigende Komplexität belasten die pädagogische Arbeit.
N. Hartmann: Jugendliche machen vieles mit sich selbst aus. Es fehlen Erholungsräume – alles ist durchgetaktet. Viele funktionieren, sind aber innerlich erschöpft und tragen Belastungen allein. Studien zeigen einen Anstieg von Schlafproblemen, Erschöpfung und psychosomatischen Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen – körperliche Signale eines dauerhaft erhöhten Stressniveaus
Welche Veränderungen sehen Sie in den letzten Jahren?
N. Hartmann: Jugendliche haben heute weniger emotionale Freiräume ohne Bewertung, und gleichzeitig mehr Selbstoptimierungsdruck. Viele erleben die Welt als unsicherer und weniger planbar – Zukunftsängste und gesellschaftliche Dauerkrisen prägen ihren Alltag. Und obwohl es Unterstützung gibt, sind die Zugänge oft schwer – viele suchen erst sehr spät Hilfe.
B. Riedel: Die Pandemie hat Entwicklungen verstärkt: weniger soziale Teilhabe, mehr digitale Zeit, Zukunftsunsicherheiten. Gleichzeitig sind Therapie- und Beratungswege sehr überlastet, was Familien stark unter Druck setzt.
K. Huber-Danzer: Kinder brauchen Halt – Erwachsene sind oft selbst belastet. Eltern jonglieren Care-Arbeit, Beruf und Erwartungen. Doppeldiagnosen mit psychischen Erkrankungen nehmen zu. Es fehlen zeitliche Ressourcen für Beziehungsgestaltung. Kinder spüren diese strukturelle Enge deutlich.
Was brauchen Kinder – unabhängig vom sozialen Hintergrund?
N. Hartmann: Jugendliche brauchen Räume, wo sie einfach sein dürfen. Zuhören und ein wertfreier Austausch können verhindern, dass kleine Themen zu großen Krisen werden. Kinder brauchen jemanden, der präsent ist und Orientierung gibt.
K. Huber-Danzer: Kinder mit Behinderung brauchen inklusive Möglichkeiten in ihren Heimatkommunen. Sie haben oft wenig Kontakt zu Kindern vor Ort. Darunter leiden sie, besonders in den Ferien.
B. Riedel: Alle großen Studien zeigen: Beziehung ist der stärkste Resilienzfaktor. Wer sich gesehen fühlt, entwickelt Vertrauen und Stabilität.
Welche Rolle können Gemeinden spielen?
K. Huber-Danzer: Strukturen, die Familien entlasten – gute Kooperationen, verlässliche Betreuung, offene Orte – wirken präventiv und stärken Kinder nachhaltig.
B. Riedel: Gemeinden gestalten Lebensräume, die psychische Gesundheit direkt beeinflussen: sichere Treffpunkte, Freizeitangebote, Übergänge zwischen Schule und Sozialraum.
N. Hartmann: Präventive, niedrigschwellige Orientierungsgespräche – außerhalb der Schule – entlasten und verhindern, dass Belastungen sich verfestigen. Dabei kann es um Klärung oder auch Weitervermittlung gehen. Offene Sprechstunden sind z. B. ein pragmatischer Beitrag, der ohne große Strukturen wirken kann.
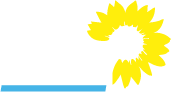





Verwandte Artikel
Conny im Interview mit dem Münchner Merkur
Steckbrief Kornelia Huber-Danzer 63 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder Leitung eines heilpädagogischen Förderzentrums in München Pädagogin M.A. Betriebswirtin im Gesundheitswesen FH Warum sind Sie die richtige Bürgermeisterkandidatin für Oberhaching? Ich…
Weiterlesen »
Unsere Bürgermeisterkandidatin
Conny Huber-Danzer stellt sich vor Am 8. März 2026 wählen Sie eine neue Bürgermeisterin für Oberhaching. Wir leben in einer wunderbaren Gemeinde. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Herausforderungen der…
Weiterlesen »
Pressemitteilung: Mittagsverpflegung in Oberhaching
Bündnis 90/Die Grünen Oberhaching fordern Kehrtwende bei Kita-Verpflegung: Frisch gekocht, regional und transparent Oberhaching, 14. Januar 2026 – Mit großer Resonanz trafen sich gestern Abend Eltern, Expertinnen und Kommunalpolitiker*innen im…
Weiterlesen »